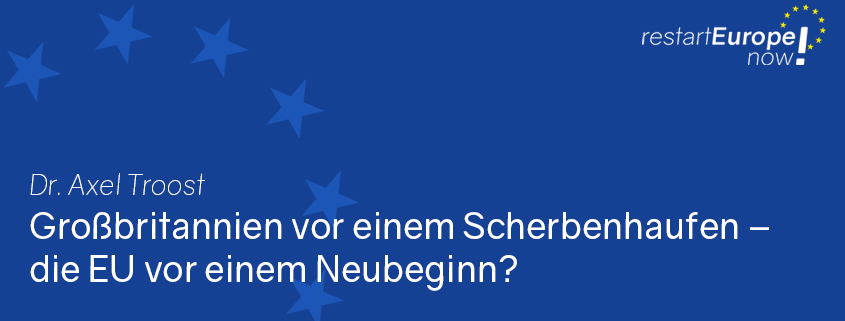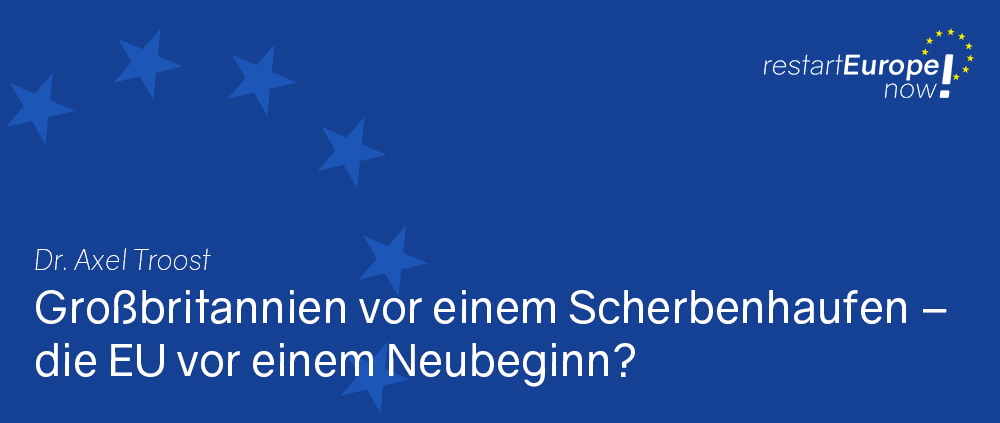Zerrissenes Großbritannien – Neubeginn in der EU?

von Dr. Axel Troost
Der Ausstieg Großbritannien aus der EU ist eine Zäsur. 52% der Abstimmenden schicken Großbritannien und die verbleibende EU in einen komplizierten politischen und ökonomischen Umbauprozess.
Die Landesteile des vereinigten Königsreiches haben z.T. unterschiedliche Mehrheiten. Für Schottland und Nordirland, die sich mehrheitlich für den Verbleib in der EU ausgesprochen haben, wird die weitere Entwicklung besonders kompliziert. Das Ergebnis des Referendums zeigt, dass die britische Gesellschaft mehrfach tief gespalten ist. Großbritannien steht als Vereinigtes Königreich und als Gesellschaft vor einer Zerreißprobe.
Seit langem hatte sich in Großbritannien ein tief sitzendes Unbehagen über die EU-Mitgliedschaft aufgebaut. Mit der Entscheidung, die Bürger bis spätestens 2017 über die EU-Mitgliedschaft abstimmen zu lassen, wollte Cameron die Europa-Skeptiker isolieren. Das ist ihm nicht gelungen. Nun hat er seinen Rücktritt für Oktober angekündigt. Gewinner des Referendums ist die rechtspopulistische UKIP. In allen Regionen, von fast allen Altersgruppen und sozialen Schichten und nicht mehr nur von den WählerInnen der Rechtspopulisten, sondern auch der konservativen Partei ist die Frage der Zuwanderung zum zentralen Entscheidungskriterium geworden.
Auch die Labourparty steht vor einer neuen Belastungsprobe. In den traditionellen Labour Hochburgen hat eine Mehrheit für den Austritt gestimmt. Unter der Führung Jeremy Corbyns hatte Labour die Kampagne „Bleiben und verändern“ gemeinsam mit dem Gewerkschaftsbund TUC gestartet. Auch hier wird ein Neuanfang unvermeidlich.
Im hohen Stimmanteil der europaskeptischen Briten widerspiegeln sich Besorgnisse, die auch in vielen anderen EU-Mitgliedsländern vorhanden sind. Teile der politischen Klasse, die für die Gestalt des aktuellen Europas als Elitenprojekt verantwortlich sind, sind damit konfroniert, dass ein „Weiter so“ nicht mehr funktioniert. Welche Veränderungen her müssen, wird die zentrale Debatte um die europäische Zukunft sein und ich werde darauf drängen, dass sich die LINKE intensiv daran beteiligt in Sinne des „Bleiben und Erneuern“. Ich werde mich weiter dafür einsetzen, dass ein auf Europa ausgerichtetes soziales Reformkonzept zu einem Hauptthema linker Politik wird.
Ich bin skeptisch, ob die überwiegend von konservativen und sozialdemokratischen Parteien dominierten europäischen Regierungen wirklich einen europapolitischen Kurswechsel in Angriff nehmen und tatsächlich die Korrektur der Fehlentwicklungen einer langen Austeritätspolitik einleiten werden. Die politische Linke in den verbliebenen 27 Mitgliedsstaaten ist zersplittert und schwach. Gleichwohl müssen wir unsere Vorstellungen für ein soziales und demokratisches Europa stärker in die Debatte hineintragen.
Für eine Reform der EU
Um die großen Leistungsbilanzungleichgewichte in der Euro-Zone endlich zu überwinden, schlage ich die Ablösung des Stabilitäts- und Wachstumspakt der EU durch eine „Europäische Ausgleichsunion“ vor. Parallel dazu brauchen wir neue Instrumente für die (Re-)Finanzierung der öffentlichen Haushalte, um sie dem Diktat privater Investorenentscheidungen zu entreißen. Die soziale Dimension der EU muss ausgebaut werden. Eine Neugewichtung und -verteilung der EU-Mittel kann dazu beitragen, das EU-Wachstum anzukurbeln und würde nebenbei den sozialen, territorialen und wirtschaftlichen Zusammenhalt in Europa stärken, anstatt ihn über Sparpolitik und Sozialkürzungen weiter auseinanderdriften zu lassen. Letzteres bereitet den Nährboden für weitere politische Spannungen und lässt den Rechtspopulismus noch stärker zunehmen.


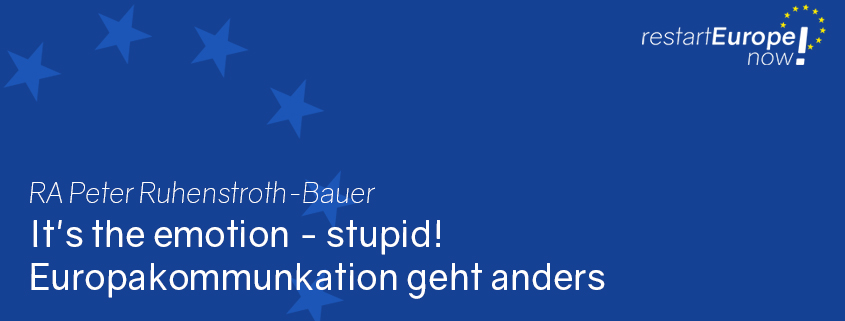
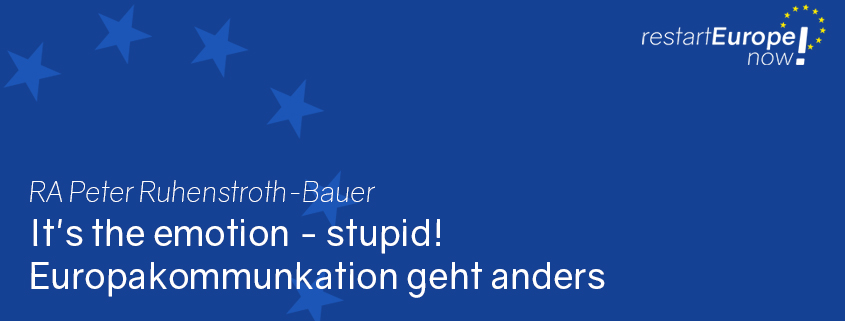

 Nach dem Austrittsvotum der Briten und dem Rückzug der Brexit-Anführer herrscht Unklarheit über die weitere Entwicklung. Das ist sichtbar am Kursverfall des britischen Pfund, der europäischen Banken und dem Schließen britischer Immobilienfonds. Schon fordert ein Vertreter der Deutschen Bank ein neues, 150 Milliarden Euro schweres Bankenrettungsprogramm. Doch die Unsicherheit ist nicht nur auf die Finanzmärkte beschränkt. Nationalistisches Denken ist zurückgekehrt nach Europa, Rechtspopulisten treiben viele Länder in gefährliche Irrwege, die politische Auseinandersetzung ist mit sprachlicher und – wie leider tragischerweise bei Jo Cox – sogar tödlicher Gewalt verbunden. Was ist nur los? Was können wir tun?
Nach dem Austrittsvotum der Briten und dem Rückzug der Brexit-Anführer herrscht Unklarheit über die weitere Entwicklung. Das ist sichtbar am Kursverfall des britischen Pfund, der europäischen Banken und dem Schließen britischer Immobilienfonds. Schon fordert ein Vertreter der Deutschen Bank ein neues, 150 Milliarden Euro schweres Bankenrettungsprogramm. Doch die Unsicherheit ist nicht nur auf die Finanzmärkte beschränkt. Nationalistisches Denken ist zurückgekehrt nach Europa, Rechtspopulisten treiben viele Länder in gefährliche Irrwege, die politische Auseinandersetzung ist mit sprachlicher und – wie leider tragischerweise bei Jo Cox – sogar tödlicher Gewalt verbunden. Was ist nur los? Was können wir tun?