 Nach dem Austrittsvotum der Briten und dem Rückzug der Brexit-Anführer herrscht Unklarheit über die weitere Entwicklung. Das ist sichtbar am Kursverfall des britischen Pfund, der europäischen Banken und dem Schließen britischer Immobilienfonds. Schon fordert ein Vertreter der Deutschen Bank ein neues, 150 Milliarden Euro schweres Bankenrettungsprogramm. Doch die Unsicherheit ist nicht nur auf die Finanzmärkte beschränkt. Nationalistisches Denken ist zurückgekehrt nach Europa, Rechtspopulisten treiben viele Länder in gefährliche Irrwege, die politische Auseinandersetzung ist mit sprachlicher und – wie leider tragischerweise bei Jo Cox – sogar tödlicher Gewalt verbunden. Was ist nur los? Was können wir tun?
Nach dem Austrittsvotum der Briten und dem Rückzug der Brexit-Anführer herrscht Unklarheit über die weitere Entwicklung. Das ist sichtbar am Kursverfall des britischen Pfund, der europäischen Banken und dem Schließen britischer Immobilienfonds. Schon fordert ein Vertreter der Deutschen Bank ein neues, 150 Milliarden Euro schweres Bankenrettungsprogramm. Doch die Unsicherheit ist nicht nur auf die Finanzmärkte beschränkt. Nationalistisches Denken ist zurückgekehrt nach Europa, Rechtspopulisten treiben viele Länder in gefährliche Irrwege, die politische Auseinandersetzung ist mit sprachlicher und – wie leider tragischerweise bei Jo Cox – sogar tödlicher Gewalt verbunden. Was ist nur los? Was können wir tun?
Eine Protestwahl – und was wir daraus lernen können
David Cameron machte mit diesem Referendum auf unverantwortliche Weise seine innerparteilichen Probleme zu einem Problem von ganz Europa. Auch die Medien spielten eine schwierige Rolle. Die Abstimmungsergebnisse vom 23. Juni zeigen, dass ein Riss durch die britische Gesellschaft geht: jüngere Menschen stimmten mit großer Mehrheit für den Verbleib, ältere dagegen. Gut sichtbar war auch die geographische Teilung: Vor allem Bürger*innen in den früheren Industrieregionen in der Mitte und im Norden des Landes stimmten für den Brexit, während London, Schottland und Nordirland mehrheitlich in der EU bleiben wollen. Eine dritte Dimension dieses Risses wurde oft nicht genannt, weil diese Diagnose unangenehmer ist: Menschen mit geringen Einkommen, Ältere und Menschen mit niedrigerem Bildungsabschluss – also die Verlierer*innen von Globalisierung und Digitalisierung – stimmten mehrheitlich gegen den Verbleib in der EU. Dazu passt auch, dass das Thema Immigration eine große Rolle in der Debatte spielte. Diejenigen, die sich als Verlierer wahrnehmen, haben traditionell am meisten Vorbehalte gegen Migrant*innen.
Ich bin überzeugt, dass diese Ergebnisse eine klare Botschaft beinhalten: Europa wird nur zusammenhalten, wenn die Gesellschaft zusammenhält. Wer sich wie wir Grünen für eine freiheitliche europäische Gesellschaft engagieren will, muss sich mit diesem dreifachen Riss beschäftigen: dem geographischen, altersmäßigen und dem sozialen Riss. Hier entsteht eine neue „soziale Frage“, die zu ignorieren gefährlich und die mit der Verteilungsfrage der 70er Jahre gleichzusetzen falsch wäre. Natürlich hat diese „soziale Frage“ eine ökonomische Dimension in der großen Vermögensungleichheit, in einer Unzufriedenheit mit einer abgehobenen Elite. Aber sie hat eben auch eine geographische Dimension. Und offensichtlich ist das Gefühl des Abgehängtseins, der Wunsch nach einer Rückkehr in die homogenere, geschlossener Gesellschaft der 50er Jahre stärker bei den älteren Menschen verankert, die für sich die Vor- und Nachteile der Digitalisierung und Globalisierung anders wahrnehmen als die Mehrheit der Jüngeren.
Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass nun ausgerechnet die Finanzbranche vor den Gefahren der wachsenden Ungleichheit warnt. Die Bank of America z.B. stellt fest, dass die Kluft zwischen Arm und Reich zu groß geworden ist und dies zu weiteren politischen Verwerfungen führen könnte: „Der Brexit ist die Antwort der Wähler auf das Zeitalter der Ungleichheit“. Das Votum zeige, dass von der wirtschaftlichen Erholung der vergangenen Jahre offenbar nur ein Teil der Bevölkerung profitiert hat. Die Lebensverhältnisse von rund 11 Millionen Haushalten – das entspricht etwa der Hälfte der Arbeitsbevölkerung in Großbritannien – sind seit dem Jahr 2002 bestenfalls stagniert oder gesunken. Als Hauptgrund werden geringe bis gar keine Lohnzuwächse bei zugleich deutlich gestiegenen Wohnkosten genannt.
Zwar negieren viele für Deutschland, dass es eine Polarisierung bei den Einkommen gegeben habe. Doch sind die Personalkosten von 17 DAX-Unternehmen zwischen 1987 und 2006 um ca. 90% gestiegen, während die Vorstandsbezüge um über 500% kletterten. Vermögen sind in Deutschland noch viel ungleicher verteilt als Einkommen. Und beim Thema Migration unterscheiden sich die Meinungen auch in Deutschland entlang regionaler, sozio-ökonomischer und Alters-Kriterien. Ein Teil der Antwort auf die jüngsten Entwicklungen in Europa muss eine glaubwürdige Politik für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft sein.
Wirtschaftliche Probleme – und wie wir sie lösen können
Die Reaktion der Märkte auf den Brexit kam prompt. Überall brachen die Börsenkurse ein, das Pfund steht zum Dollar so niedrig wie schon seit über 30 Jahren nicht mehr. Die Sorge ist, dass der Brexit der britischen Wirtschaft schweren Schaden zufügen wird. Aber auch andernorts in Europa schrillten die Alarmglocken. Den italienischen Banksektor traf es besonders hart. Dort führte eine langanhaltende Rezession zum Auflaufen riesiger Berge an notleidender Kredite auf den Bankbilanzen. Der Brexit-Schock ließ italienische Bankaktien seither um über 30% einbrechen. Die EU musste bereits einen Garantierahmen in Höhe von 150 Milliarden Euro für italienische Banken genehmigen. Der Chefvolkswirt der Deutschen Bank fordert zusätzlich Kapitalhilfen von 150 Milliarden Euro Steuergeld für eine Stabilisierung der europäischen Banken. Das wäre ein Bruch mit den neuen Bankenregeln, die genau solche Staatshilfen verbieten. Damit wird als Reaktion auf die Probleme des Bankensektors genau das vorgeschlagen, was schon seit 2008 gemacht wurde: Bankschulden auf den Staatssektor übertragen. Diesen Fehler dürfen wir nicht noch einmal machen!
Das Gegenteil von alldem ist nötig: Wir sollten die Grundlage für die Schwierigkeit der Banken angehen. Und das ist bei den italienischen Banken eindeutig die seit Jahren andauernde Wirtschaftskrise. Sie verursacht, dass Haushalte und Unternehmen ihre Kredite nicht mehr bedienen können und diese „faule Kredite“ werden. Deswegen braucht es einen Kurswechsel für mehr reale Investitionen.
Die europäischen Banken haben in den letzten Jahren ihre Kapitalbasis nicht genug gestärkt, sondern Milliarden an Gewinnen ausgeschüttet. Jetzt fehlen diese Milliarden und es wird wieder nach dem Steuerzahler gerufen. Das Gegenteil ist nötig: Es braucht eine Politik, die Banken dazu zwingt, in guten Zeiten Kapital anzusparen, damit für schlechte Zeiten vorgesorgt ist. Deswegen haben wir Grünen seit Jahren eine Schuldenbremse für Banken gefordert. Und in schlechten Zeiten müssen die Aktionäre und Gläubiger herangezogen werden, um Verluste zu tragen, wenn der Kapitalpuffer nicht reicht.
Man kann Europa nur zusammenhalten, wenn man die Gesellschaft zusammenhält. Deshalb darf es keine Fortsetzung der Politik der vergangenen Jahre geben, die Banken schont, Zukunftsinvestitionen vernachlässigt und eine Spaltung der Gesellschaft zulässt. Es gilt jetzt, den sozialen Zusammenhalt der europäischen Bürgerschaft zu stärken, in jedem Mitgliedstaat und in Europa insgesamt. Das gelingt zum Beispiel durch eine Wende zu fairer Steuerpolitik, die Superreiche stärker besteuert und Privilegien für große Konzerne abbaut. Und Europa muss endlich den Weg aus der Krise finden. Denn anders als die USA ist Europa immer noch fest im Griff der Finanzkrise, die 2007 ausgebrochen ist. Dafür braucht es einen Green New Deal – eine Strategie für mehr staatliche und private Investitionen in Bildung, Integration von Flüchtlingen und in den ökologischen Umbau unserer Wirtschaft.



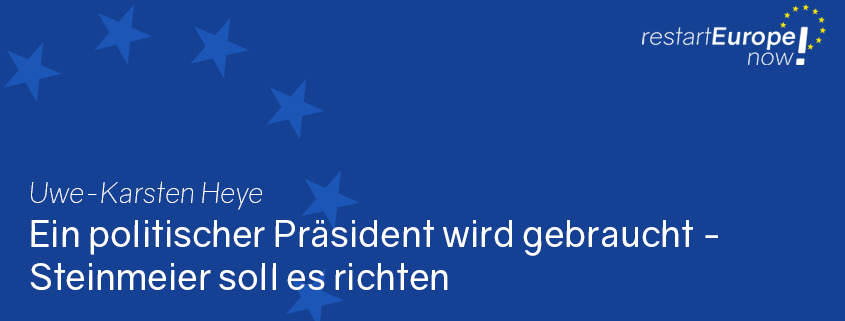







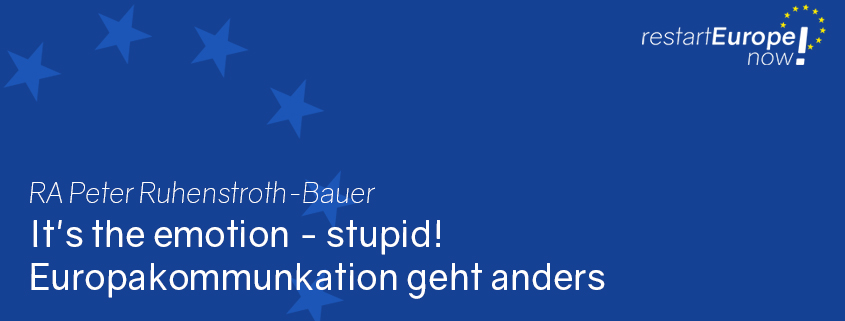
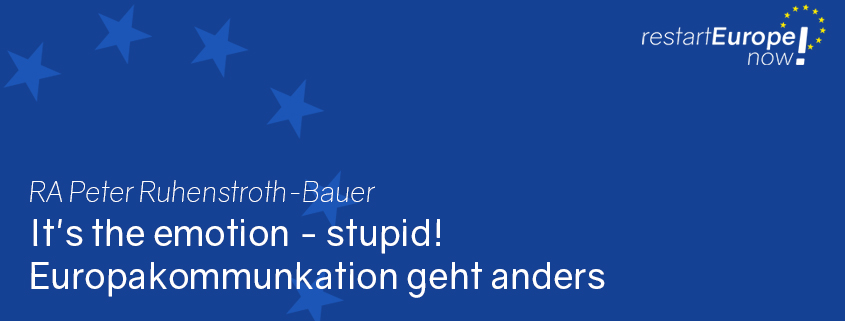

 Nach dem Austrittsvotum der Briten und dem Rückzug der Brexit-Anführer herrscht Unklarheit über die weitere Entwicklung. Das ist sichtbar am Kursverfall des britischen Pfund, der europäischen Banken und dem Schließen britischer Immobilienfonds. Schon fordert ein Vertreter der Deutschen Bank ein neues, 150 Milliarden Euro schweres Bankenrettungsprogramm. Doch die Unsicherheit ist nicht nur auf die Finanzmärkte beschränkt. Nationalistisches Denken ist zurückgekehrt nach Europa, Rechtspopulisten treiben viele Länder in gefährliche Irrwege, die politische Auseinandersetzung ist mit sprachlicher und – wie leider tragischerweise bei Jo Cox – sogar tödlicher Gewalt verbunden. Was ist nur los? Was können wir tun?
Nach dem Austrittsvotum der Briten und dem Rückzug der Brexit-Anführer herrscht Unklarheit über die weitere Entwicklung. Das ist sichtbar am Kursverfall des britischen Pfund, der europäischen Banken und dem Schließen britischer Immobilienfonds. Schon fordert ein Vertreter der Deutschen Bank ein neues, 150 Milliarden Euro schweres Bankenrettungsprogramm. Doch die Unsicherheit ist nicht nur auf die Finanzmärkte beschränkt. Nationalistisches Denken ist zurückgekehrt nach Europa, Rechtspopulisten treiben viele Länder in gefährliche Irrwege, die politische Auseinandersetzung ist mit sprachlicher und – wie leider tragischerweise bei Jo Cox – sogar tödlicher Gewalt verbunden. Was ist nur los? Was können wir tun?
 Auch nach den Wahlen vom 26. Juni existiert in Spanien ein politisches Patt. Die Neuwahlen haben keine grundsätzlich veränderte Konstellation gegenüber dem Wahlergebnis vom Dezember des letzten Jahres hervorgebracht. Zwar konnte die konservative Partido Popular (PP) des amtierenden Ministerpräsidenten Rajoy ihren Stimmenanteil erhöhen, allerdings überwiegend auf Kosten der liberalen Ciuadadonos. Unidos Podemos, das Bündnis der aus der Bewegung der „Indignados“ hervorgegangenen Podemos und der Izquierda Unida verfehlte ihr Ziel zweitstärkste politische Partei vor der sozialdemokratischen PSOE zu werden deutlich. Zwar konnte sie ihr prozentuales Ergebnis vom Dezember im Wesentlichen halten, verlor aber insgesamt 1,2 Millionen Stimmen gegenüber den Wahlen vom Dezember. Obwohl noch immer zweitstärkste Partei verlor die PSOE fünf Sitze und erzielte ihr schlechtestes Ergebnis der jüngeren Geschichte.
Auch nach den Wahlen vom 26. Juni existiert in Spanien ein politisches Patt. Die Neuwahlen haben keine grundsätzlich veränderte Konstellation gegenüber dem Wahlergebnis vom Dezember des letzten Jahres hervorgebracht. Zwar konnte die konservative Partido Popular (PP) des amtierenden Ministerpräsidenten Rajoy ihren Stimmenanteil erhöhen, allerdings überwiegend auf Kosten der liberalen Ciuadadonos. Unidos Podemos, das Bündnis der aus der Bewegung der „Indignados“ hervorgegangenen Podemos und der Izquierda Unida verfehlte ihr Ziel zweitstärkste politische Partei vor der sozialdemokratischen PSOE zu werden deutlich. Zwar konnte sie ihr prozentuales Ergebnis vom Dezember im Wesentlichen halten, verlor aber insgesamt 1,2 Millionen Stimmen gegenüber den Wahlen vom Dezember. Obwohl noch immer zweitstärkste Partei verlor die PSOE fünf Sitze und erzielte ihr schlechtestes Ergebnis der jüngeren Geschichte.
